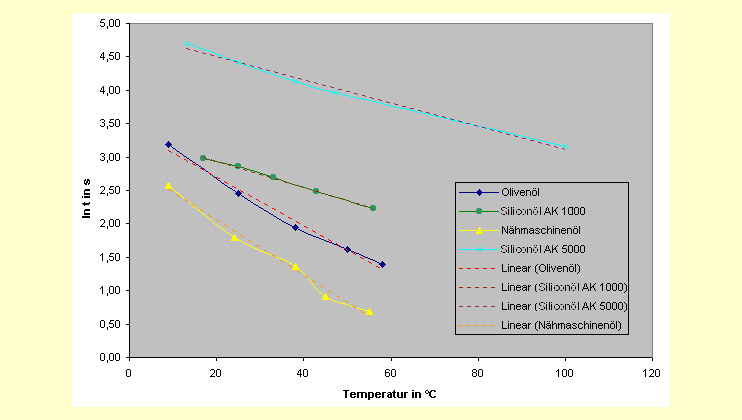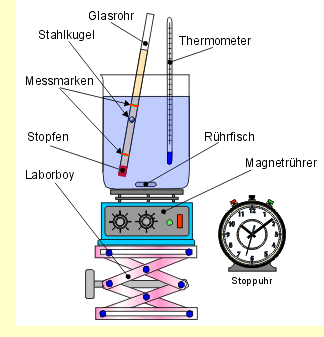|
1. Experiment ist im WACKER-Schulversuchskoffer enthalten |
nein |
2. Versuchsvorschrift wurde modifiziert |
/ |
3. Eigene Versuchsvorschrift wurde entwickelt |
ja |
4. Video-Clip verfügbar |
nein |
5. Flash-Animation verfügbar |
nein |
6. Weitere Materialien: Arbeitsblätter
9 |
|
 |
Viskosität von Siliconölen/Variante a |
 |
  1
Materialien, Chemikalien, Zeitbedarf 1
Materialien, Chemikalien, Zeitbedarf |
 |
- Hebebühne
- Stativ
- Magnetrührplatte und -stäbchen
- Becherglas 1 l
- Glasrohr (Länge = ca. 50 cm, Æ = 6 mm)
- 2 Metallkugeln ( Æ = 3,5 mm und
5,5 mm)
- Thermometer(100 °C)
- Stoppuhr
- Magnetangel
- kleiner Plastiktrichter
- dünner Permanentfilzschreiber
- Geodreieck
- passender Gummistopfen
Eine einzelne Messung, bei gegebener Temperatur, dauert
ungefähr 5 Minuten. Die Gesamtdauer der temperaturvariablen Messreihe
hängt vor allem von den Aufheiz- bzw. Abkühlungszeiten des Wasserbades
ab und ist schlecht vorhersagbar. Im allgemeinen sollten jedoch bei gut
überlegter Vorgehensweise 1,5 Stunden für die Messreihe ausreichen
(siehe 4 Tipps und Anmerkungen).
Messreihen mit anderen Ölen nehmen mehr Zeit in Anspruch, da das
Rohr jedesmal gespült, getrocknet und wieder temperiert werden muss. |
 |
  2
Versuchsdurchführung und -beobachtung 2
Versuchsdurchführung und -beobachtung |
 |
 |
 |
Die Versuchsapparatur wird gemäß der
Skizze aufgebaut.
Das Glasrohr wird mit einem Winkel von ca.10° leicht schräg
eingespannt. Für die spätere Auswertung ist es unerheblich
welcher Winkel exakt anliegt, da dieser in die Apparaturkonstante
miteinfließt. Es muss jedoch zum Vergleich der Werte gewährleistet
sein, dass alle Messungen bei exakt dem gleichen Winkel ablaufen.
Dies wird durch die feste Position der Halteklemme erreicht. Diese
wird im gesamten Versuch nicht mehr verändert.
Vor dem Einspannen wird das Glasrohr an zwei Stellen mit Markierungen
versehen und zwar ca. 3 cm unterhalb der Wasseroberfläche und
1,5 cm oberhalb des Gummistopfens.
Anschließend wird das Rohr mit dem jeweiligen Öl blasenfrei
gefüllt, die Stahlkugel hinzugegeben und das Rohr eingespannt.
Zur Temperierung des Glasrohres muss dieses mindestens 5 Minuten bei
dieser Temperatur verweilt haben bevor die Messung beginnt. |
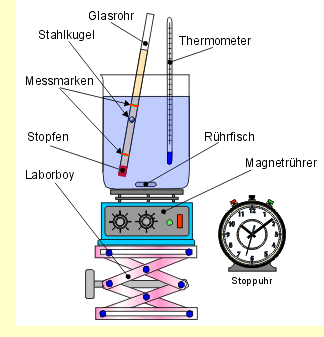 |
|
| Bei der eigentlichen Messung wird die Stahlkugel, mit
dem ebenfalls temperierten Magneten, bis ca. 1 cm unter die Wasseroberfläche
gezogen und danach die Fallzeit der Kugel zwischen den Markierungen gestoppt.
Für jede Temperatur werden 5 Fallzeiten gemessen. |
 |
 |
 |
 |
|
Falls die Fallzeit mit der größeren
Kugel zu lange dauert, sollte die kleinere Kugel verwendet werden.
Dies hat auf die Temperaturabhängigkeit keinen Einfluss.
Es wird für jedes Öl (siehe Chemikalienliste) die Fallzeit
bei fünf, sich jeweils um ca. 10 °C unterscheidenen Temperaturen
bestimmt (ca. 10 °C, Raumtemperatur, 35 °C, 45 °C, 55
°C).
Beim Versuch läßt sich beobachten, dass die Fallzeit der
Kugel mit steigender Temperatur bei allen Ölen abnimmt.
Die Fallzeit ist bei den Siliconölen bedeutend größer
als bei den anderen untersuchten Ölen. |
|
 |
  Bei
einem Referenzversuch wurden folgende Fallzeiten gemessen: Bei
einem Referenzversuch wurden folgende Fallzeiten gemessen: |
 |
| |
|
Fallzeit in s |
| ÖL |
Temperatur
in °C |
Nr. 1 |
Nr. 2 |
Nr. 3 |
Nr. 4 |
Nr. 5 |
Æ |
 |
Olivenöl
Æ (Kugel)
= 5.5 mm
|
9 |
24,80 |
24,00 |
24,20 |
24,00 |
24,00 |
24,20 |
| 25 |
11,10 |
11,20 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
11,66 |
| 38 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 50 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 58 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
 |
Nähmaschinen
öl
Æ (Kugel)
= 5.5 mm |
9 |
13,00 |
13,50 |
13,50 |
13,00 |
13,00 |
13,20 |
| 24 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 38 |
3,80 |
4,00 |
4,00 |
3,80 |
3,80 |
3,88 |
| 45 |
3,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
2,50 |
2,50 |
| 55 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
 |
Siliconöl
AK 5000
Æ (Kugel)
= 3.5 mm |
13 |
112,00 |
109,00 |
108,00 |
109,00 |
109,00 |
109,40 |
| 25 |
86,00 |
80,00 |
85,00 |
83,00 |
83,00 |
83,40 |
| 38 |
60,00 |
64,00 |
64,00 |
60,00 |
62,00 |
62,00 |
| 47 |
53,00 |
54,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,20 |
| 100 |
24,00 |
24,00 |
22,00 |
24,00 |
23,00 |
23,40 |
 |
Silconöl
AK 1000
Æ (Kugel)
= 3.5 mm |
17 |
19,70 |
19,20 |
20,00 |
20,10 |
20,00 |
19,80 |
| 25 |
18,00 |
17,00 |
18,00 |
17,00 |
17,00 |
17,40 |
| 33 |
14,90 |
14,00 |
15,00 |
15,00 |
14,90 |
14,76 |
| 43 |
12,00 |
12,00 |
11,80 |
12,00 |
12,00 |
11,96 |
| 56 |
9,00 |
9,80 |
9,90 |
9,00 |
9,00 |
9,34 |
|
 |
| Wie man sehen kann, sind die Messwerte untereinander sehr
gut reproduzierbar. |
 |
  3
Versuchsauswertung 3
Versuchsauswertung
|
 |
| Der natürliche Logarithmus der Fallzeit
nimmt linear mit der Temperatur ab. Das ist hier graphisch anhand der Messwerte
des obigen Referenzversuchs dargestellt. |
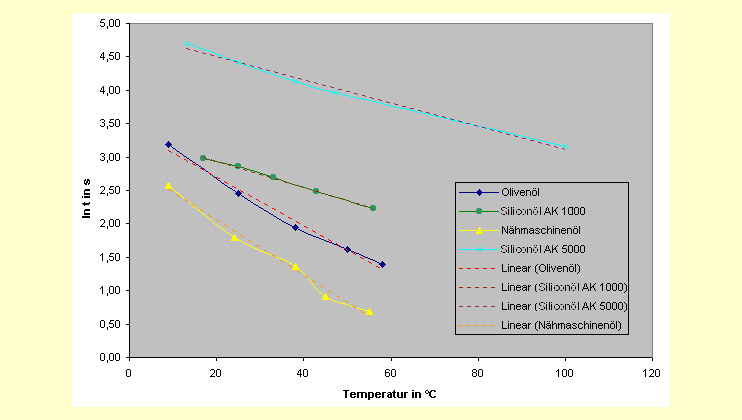 |
Zusätzlich ist an der Steigung der
Geraden zu erkennen, dass die Abhängigkeit der Viskosität (die
proportional zur hier gemessenen Fallzeit ist) von der Temperatur bei den
Siliconölen wesentlich geringer ist als bei den anderen Vergleichsölen.
Diese Eigenschaft der Siliconöle ist von großer Bedeutung für
ihre Verwendung bei hydraulischen Anlagen, die bei großen Temperaturschwankungen
zuverlässig arbeiten müssen. Das ist bei Flugzeugen der Fall,
wo Mineralöle ungeeignet wären, weil ihre Viskosität zu stark
von der Temperatur abhängt. |
 |
  4
Tipps und Anmerkungen 4
Tipps und Anmerkungen
|
 |
- Im Schulgebrauch empfiehlt es sich, auf die Berechnung der Viskosität
aus der gemessenen Fallzeit zu verzichten und es dabei zu belassen,
dass die Viskosität und die Fallzeit in einer "je größer,
desto größer" Relation stehen.
- Es empfiehlt sich die Fallzeiten der Siliconöle als letztes zu
bestimmen, da sich diese nur schwer aus dem Glasrohr entfernen lassen.
- Um die Versuchsdauer zu verkürzen, empfiehlt es sich, zwei große
Bechergläser mit sehr heißem und kaltem Wasser in Vorrat
zu halten und die Messtemperaturen schnell einstellen zu können.
- Metallkugeln unterschiedlicher Größe sind z.B. in einem
Fahrradgeschäft erhältlich.
- Mit dem Versuch lässt sich gut zeigen, dass die Temperaturabhängigkeit
der Viskosität (Fallzeit) bei Siliconölen geringer ist als
bei anderen Ölen. Dieses Verhalten kann man mit dem linearen Aufbau
und den geringen Wechselwirkungen zwischen Silicon-Molekülen erklären.
- Der Versuch lässt sich z.B. in der Sekundarstufe II bei der Einführung
des Begriffs Viskosität einsetzen. Normalerweise werden dabei nur
organische Öle untersucht. Hier bietet sich Siliconöl aufgrund
seiner speziellen Eigenschaften und seiner wichtigen Stellung in der
Industrie als Vergleichsöl an.
- Der Versuch eignet sich aufgrund der einfachen Durchführung und
der Ungefährlichkeit der verwendeten Chemikalien sehr gut als Schülerversuch.
Um Zeit zu sparen, könnten die Schüler dabei in Gruppen die
verschiedenen Öle untersuchen.
- Bei der Auswertung sollte ein Computer eingesetzt werden, um die Medienkompetenz
der Schüler zu schulen. Die Auswertung könnte dabei als Hausaufgabe
dienen.
|
 |
  5
Ergänzende Sachinformationen 5
Ergänzende Sachinformationen
|
 |
Unter der Viskosität, versteht man
die Eigenschaft einer Flüssigkeit der gegenseitigen Verschiebung zweier
benachbarter Schichten einen Widerstand (Zähigkeit, innere Reibung)
entgegenzusetzen. Man definiert heute die sog. dynamische
Viskosität η =
t/D als das Verhältnis der Schubspannung zum Geschwindigkeitsgradienten
senkrecht zur Strömungsrichtung.
Bei Newtonschen Flüssigkeiten ist die Viskosität
bei gegebener Temperatur eine Stoffkonstante, bei Nicht-Newtonschen
Flüssigkeiten ist das nicht der Fall. Hier kommt es je nach
Fließgeschwindigkeit zu einer Fließerweichung (Abnahme der Viskosität)
oder zu einer Fließverfestigung (Zunahme der Viskosität). Diese
Phänomene sind beispielsweise dann zu beobachten, wenn pastöse
Flüssigkeiten (Zahnpasta, Malerfarben u. a.) aus Tuben heraus gedrückt
und rasch verstrichen werden. |
 |
  6 Literatur 6 Literatur |
 |
| A. Tomanek: Silicone & Technik, Ein
Kompendium für Praxis, Lehre und Selbststudium, Hanser, München,
Wien (1990) |
 |
  | Home | Uni Wuppertal | WACKER | Didaktik | Sachinfo | Versuche | Medien | Kontakt | | Home | Uni Wuppertal | WACKER | Didaktik | Sachinfo | Versuche | Medien | Kontakt | |
|